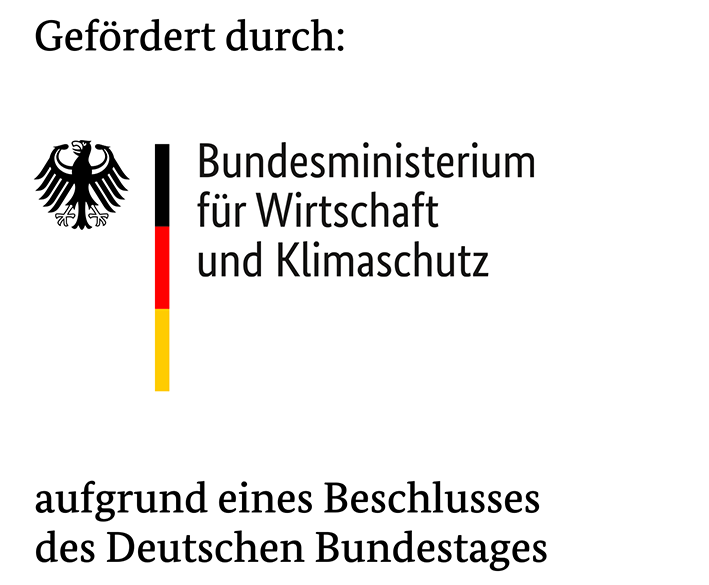Smart Grid im Schwarzwald getestet
flexQgrid-Projektpartner stellen ihre Ergebnisse vor

Smart Grid im Schwarzwald getestet
flexQgrid-Projektpartner stellen ihre Ergebnisse vor
Erfolgreicher Praxistest fürs intelligente Verteilnetz in Freiamt: Die Projektpartner des Vorhabens flexQgrid haben jetzt die Ergebnisse aus dreieinhalb Jahren intensiver Forschung präsentiert. Die Haupterkenntnis: Das Netz der Zukunft kann schon heute Wirklichkeit werden.
Viele Netzkunden des Konsortialführers NetzeBW möchten möglichst viel ihres Strombedarfs mittels Photovoltaik-Anlagen selbst lokal und klimafreundlich erzeugen. Das Projektteam hatte es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, die durch die stetig steigende Zahl an Prosumern entstehenden Engpässe im Niederspannungsnetz zu erkennen und zu beheben. Das Ziel: auch künftig einen wirtschaftlichen und sicheren Netzbetrieb ermöglichen.
Forschende und Bürger arbeiten eng zusammen
Um zu zeigen, dass die technischen Lösungen praktisch funktionieren, testeten die Fachleute sie im Rahmen eines 17-monatigen Feldtests im realen Betrieb. Dabei arbeitete das Team eng mit Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Freiamt zusammen. Die Gemeinde ist einer der sonnenreichsten Orte in Baden-Württemberg und viele Einwohner sind der Energiewende gegenüber sehr offen eingestellt.

Im Testnetz installierten die Forschenden bei 41 Feldtestteilnehmenden Mess-, Steuer- und Kommunikationstechnik und vernetzten die eingebundenen Anlagen miteinander.
Fünf Hauptergebnisse arbeitete das Forschungsteam heraus:
- Um Flexibilität effizient nutzen zu können ist es erforderlich, die Schnittstellen zwischen Kundenanlagen, Energiemanagementsystemen und intelligenten Messsystemen zu standardisieren.
- Damit ein Smart Grid zuverlässig betrieben werden kann, müssen eine robuste Kommunikationsinfrastruktur und zentrale und lokale Systeme optimal zusammenspielen.
- Den aktuellen technischen Standards und Regeln entsprechende intelligente Messsysteme wurden erfolgreich eingesetzt. Das Team identifizierte Weiterentwicklungspotenziale, die den Nutzen für Netzbetreiber, Kunden und Marktteilnehmer erhöhen würden.
- Die Netzampel funktioniert: Engpässe konnten vorausschauend vermieden sowie automatisiert und zielgerichtet behoben werden.
- Das Potenzial der Flexibilitätsnutzung kann gehoben werden. Das gelingt, wenn Netzkunden akzeptieren, dass Netzbetreiber das Energiemanagementsystem im Engpassfall aktiv steuern und zum Beispiel die Leistung am Netzanschlusspunkt vorübergehend senken. Für Netzkunden bedeutet dies beispielsweise, dass ihr Elektro-Auto etwas später oder mit weniger Leistung lädt oder ihr PV-Batteriespeicher nicht schon morgens, sondern erst mittags lädt.
Erkenntnisse sollen für Regulatorik genutzt werden

Projektleiterin Carmen Exner von NetzeBW sagt: „Ich freue mich, dass wir mit unseren Forschungsfragen hochaktuelle Energiewende-Themen berühren und nun konkrete Antworten geben können.“ Die Elektrotechnikerin hoffe, dass die Ergebnisse zu den laufenden Diskussionen rund um Engpassmanagement und Smart Meter beitragen können.
„Ich denke dabei zum Beispiel an die Neugestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes und an das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende.“ Sollten die Ergebnisse in politische Entscheidungen einfließen, könnten neue Anlagen bald schnell ans Netz angebunden werden. Für die Zukunft empfiehlt das Projektteam, weiterführende Forschungsfragen in folgenden Vorhaben, insbesondere zum präventiven Engpassmanagement, zu berücksichtigen. (kkl)
Kurz erklärt: Darum geht's im Projekt flexQgrid
Die Partner untersuchten den Einsatz von Flexibilität in der Niederspannungsebene des Verteilnetzes in Freiamt. Sie wollten wissen: Welche Anreize bringen die Feldtestteilnehmer dazu, netzdienliche Flexibilität bereitzustellen? Dafür wurden beim Feldtest Haushalte und weitere Photovoltaik (PV)-Anlagen verbunden. Die Einfamilienhäuser erzeugten mithilfe von PV-Anlagen großteils selbst Energie. Zum Teil waren sie auch mit Batteriespeichern, Wärmepumpen und Elektro-Autos mit Ladestationen ausgestattet. Alle Anlagen rüstete das Team mit moderner Mess- und Steuerungstechnik aus, sodass sie von einem Energiemanagementsystem gesteuert werden können.
„Corona ist ganz klar unsere größte Herausforderung“: Interview mit Carmen Exner vom 25.05.2021Förderung
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert das Projekt flexQgrid innerhalb des Schwerpunkts „Stromnetze“. Den Rahmen dafür bildet das 7. Energieforschungsprogramm. Hier finden Sie weitere Informationen zur Forschungsförderung.
Website flexQgrid

Hier finden Sie weiterführende Informationen und Veröffentlichungen, wie eine Abschlussbroschüre und eine Machbarkeitsstudie, zum Herunterladen.
mehr