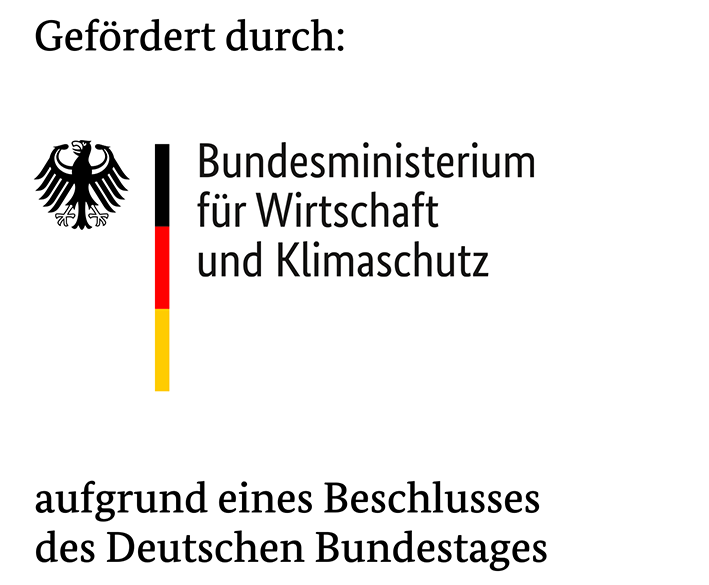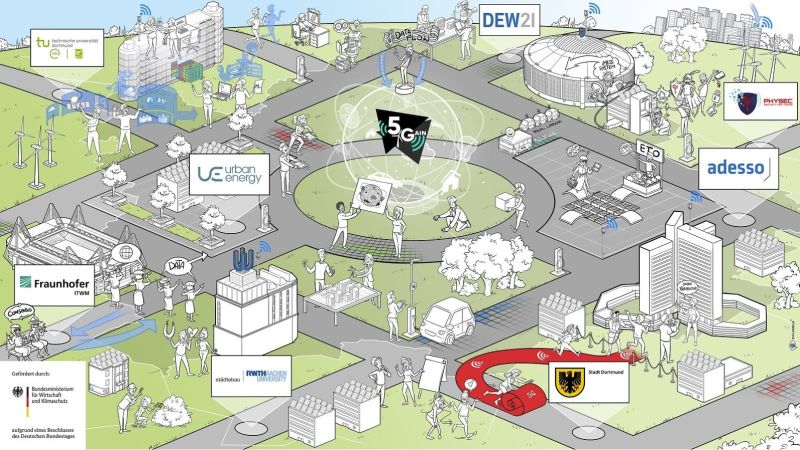Energiewende und Bevölkerung zusammenbringen
Von der Energieerzeugung bis zum Endverbrauch – damit die Energiewende gelingt, müssen alle gesellschaftlichen Akteure mitmachen. Umgekehrt wirkt sich der Umbau des Energiesystems auf die Lebens- und Arbeitswelt jedes Einzelnen aus. Forschende untersuchen, wie die Anliegen der Bevölkerung in diesem Wechselspiel am besten berücksichtigt werden können.
Energiewende: Warum ist gesellschaftliche Akzeptanz so wichtig?
Für einen umfassenden gesellschaftlichen Transformationsprozess wie die Energiewende müssen alle ins Boot geholt werden. Denn um das Energiesystem erfolgreich umzubauen, ist breite Unterstützung und aktives Mitgestalten notwendig. Dabei geht es um Bevölkerung genauso wie um Kommunen als Ganzes und um andere öffentliche Einrichtungen, um zivilgesellschaftliche Multiplikatoren und Energieversorger genauso wie um Planung und Handwerk.
Grundvoraussetzung einer breiten Unterstützung für Energiewendemaßnahmen ist Akzeptanz. Und darin liegt eine zentrale Herausforderung: Einerseits besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Energiewende angesichts des Klimawandels unbedingt notwendig ist.
Andererseits geschieht die Energiewende dezentral und lokal: Strom- und Wärmeerzeugungsstrukturen sind mit dem zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien stärker in den unmittelbaren Alltag der Bevölkerung integriert. Sei es durch einen Windpark in Ortsnähe, die Solaranlage auf dem eigenen Dach oder neue, energiesparende Prozesse im Job.
Daher betrachten und erforschen Fachleute aus einer gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive, wie sich etwa Digitalisierung und Technikgestaltung auf das individuelle Arbeits- und Lebensumfeld auswirken.
Bürgerbeteiligung fördert die Akzeptanz
Ob Strukturwandelmaßnahmen in traditionellen Energieregionen wie der Lausitz oder im Rheinland, der Bau von Stromtrassen, um den grünen Strom dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird oder die Auswirkungen auf den Strompreis – die Akzeptanz für diese Veränderungen ist entscheidend dafür, wie gut und schnell die Energiewende gelingen kann.
Teilhabe ist hier das zentrale Stichwort: Es gilt, gesellschaftliche Akteure und Multiplikatoren frühzeitig über Maßnahmen zu informieren und bei Veränderungsprozessen aktiv einzubinden. Das geschieht etwa mithilfe verschiedener Formen der Bürgerbeteiligung.

Ein Beispiel dafür sind Energiegenossenschaften. Diese Form der Beteiligung kann Akzeptanz und Motivation für die Energiewende in breiten Teilen der Gesellschaft fördern. Derzeit engagieren sich bereits mehr als 180.000 Menschen in 860 beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband organisierten Energiegenossenschaften.
Genossenschaftliche Erneuerbare-Energien-Projekte beschäftigen sich beispielsweise mit Energieproduktion und -versorgung, (Wärme-)Netzbetrieb und Fragen der Vermarktung.
Die Mitglieder sind zugleich Eigentümer und Kunden ihrer Genossenschaft, beziehen etwa als kleines lokales Unternehmen Strom vom genossenschaftlich betriebenen Windpark in der Nähe. Das genossenschaftliche Engagement hat vor allem das Ziel, die individuelle wirtschaftliche Existenz zu fördern.
Wie die Bevölkerung wirtschaftlich profitiert
Eine andere Möglichkeit ist die direkte Beteiligung. Hier steht die Rendite im Vordergrund. Die Bürgerinnen und Bürger des Orts, in dem etwa auf einer Freifläche ein sogenanntes Solarfeld entsteht, können sich dabei als Mitunternehmer einbringen. Auf diese Weise tragen sie einerseits das wirtschaftliche Risiko mit, andererseits profitieren sie von den Erlösen der Anlage.
Auch solche Konzepte werden erforscht, um die besten Maßnahmen zur Beteiligung zu finden und die Akzeptanz weiter zu verbessern. So kann der Umbau des Energiesystems vor Ort bildlich oder auch ganz wörtlich gesprochen ein Gewinn für die Bevölkerung werden.